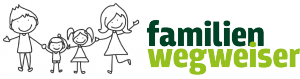Auf dem Weg zur Inklusion
Inklusion bedeutet Heterogenität, keine Abgrenzungen, eine gewisse Art von Chancengleichheit. Inklusion ist ein Gesellschaftsgedanke und nicht bloß ein schulisches Modell! Doch das ist noch lange nicht in den Köpfen aller angekommen. Eine weit verbreitete Sicht auf die Dinge ist die, dass Inklusion noch immer eine Art von Abgrenzung ist. Doch das ist falsch.
Die Entwicklungsphasen der Sonderpädagogik
So gab es die Phasen Exklusion und Separation, in der „gesunde“ und „behinderte“ Kinder getrennt voneinander beschult wurden. Bis in die 70er Jahre aber wurden in der Realität Kinder und Jugendliche mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen gar nicht beschult. Dabei formulierte man im Potsdamer Abkommen 1945 die Demokratisierung als Leitziel der Schulreform. Um die Demokratisierung zu realisieren sollte besonders die Chancengleichheit aller Heranwachsenden berücksichtigt werden. Dies aber wurde nicht oder nur in Teilen realisiert.
Darauf folgte die Phase der Integration: Hier kam es erstmals zur Aufnahme von Kindern mit Behinderung in Regelschulen. Dies geschah erstmals 1973 durch den Deutschen Bildungsrat. 1994 wurde dies dann auch im Grundgesetz festgehalten: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
Als nächste und derzeit aktuelle Phase kam die Inklusion: In Deutschland etablierte sich der Begriff Inklusion im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 2006. Sinn ist die Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte Menschen anstelle von Diskriminierung. Eines der zentralen Merkmale des Inklusionsbegriffs ist der Einbezug aller Heterogenitätsdimensionen wie beispielsweise Herkunft, soziale Lage, Geschlecht, Kultur, Sprache etc.. Es wird sich also weder auf das eine noch auf das andere fokussiert. Also auch nicht auf Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. Die Heterogenität wird genutzt und jeder erhält die gleichen Chancen und Umstände.
Die Gefahren der Inklusion
Doch die Inklusion birgt auch viele Gefahren. Durch die Bedeutung der Inklusion neigen wir eventuell dazu besonderen Förderbedarf nicht ausreichend zu berücksichtigen, da wir schließlich alle gleich sind und nicht unterschiedlich behandelt werden sollen. Doch brauchen einige Schülerinnen und Schüler gewisse Unterstützung. Mit dieser Zurückhaltung oder sogar Weigerung, besonderen Förderbedarf zu benennen, besteht die Gefahr, dass notwendige spezifische Maßnahmen nicht oder nur ungenügend getroffen werden. Wir sollten uns also von dem Homogenisierungswahn distanzieren.
Auch ein offener Unterricht birgt für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf Gefahren, denn strukturierende Maßnahmen, auf die insbesondere Lernende mit besonderem Förderbedarf angewiesen sind, stehen nicht in genügendem Maße zur Verfügung.
Eine weitere Gefahr ist die noch immer vorkommende Benennung vom „Inklusionskind“. Es wiederspricht dem Inklusionsgedanken. Schließlich hebt die Bezeichnung „Inklusionskind“ das Anderssein heraus, obwohl dies durch die Inklusion vermieden werden soll. Wenn man den Begriff verwenden möchte, sind alle Schülerinnen und Schüler an Inklusionsschulen, mit oder ohne Förderbedarf, „Inklusionskinder“.
Als letzten Punkt muss das Etikettierungs-Dilemma angesprochen werden. Auch dies resultiert aus der Gefahr, alle Schülerinnen und Schüler gleich zu behandeln und dadurch besondere Förderbedarfe nicht mehr ausreichend zu berücksichtigen. Schließlich können nur dann die nötigen Ressourcen beantragt werden, wenn Lehrpersonen spezielle Schülerinnen und Schüler etikettieren. Doch auch das wiederspricht dem Inklusionsgedanken. Das Ziel also sollte eine systematische Verteilung von Ressourcen sein.